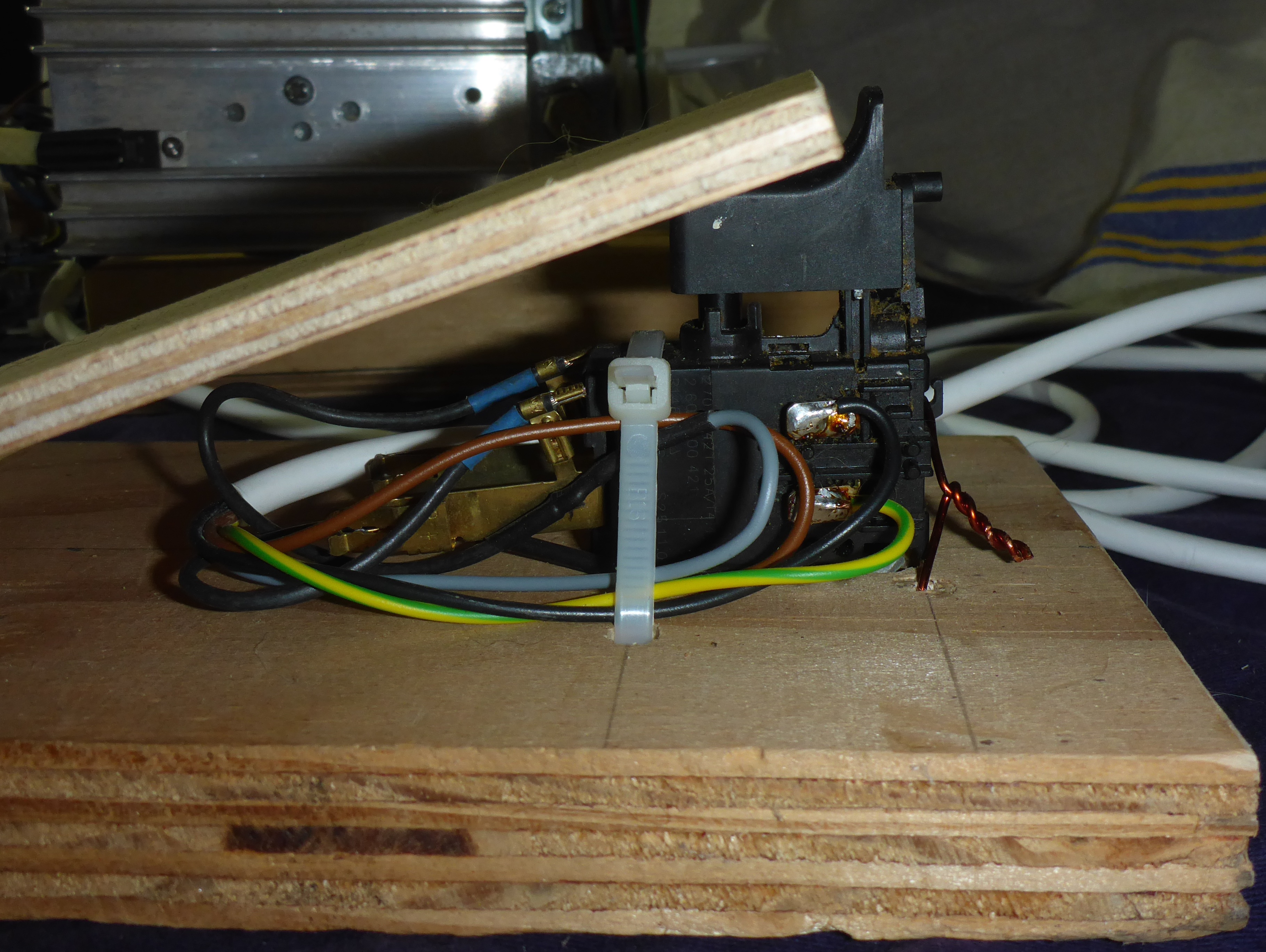Im backstrapweaving-Forum auf Ravelry habe ich vor zwei Wochen einen Hinweis auf eine sehr interessante Anleitung von Annie MacHale zum Weben dreifarbiger Muster gefunden. Sie hat einseitige dreifarbige Webmuster von litauischen Gürteln analysiert und herausgefunden, wie diese gewebt werden. Der Einzug für diese Muster kam mir bekannt vor. Ich habe eine Manta aus dem Gebiet um Lares / Peru, bei der die Kette für ein dreifarbiges Komplementärmuster auf genau diese Art geschärt war. Dieses Muster konnte ich jedoch bisher nicht weben.
 Musterbereich in Leinenbindung
Musterbereich in Leinenbindung

dreifarbiges Muster mit diagonalem Farbverlauf
Annies Anleitung ist für Muster, die nicht komplementär sind. Die Unterseite zeigt das melierte Grundgewebe und in den Musterbereichen ist der Schußfaden sichtbar.
Es war jedoch nicht schwierig herauszufinden, wie man das Muster (so wie in der Manta) auch auf die Unterseite bekommt.
Hier die Bilder vom nachgewebten Muster, Vorder- und Rückseite:
Das ist die Weberei „ohne Plan“ 😉 . Es ist nur schwer möglich, diese Muster in einem Webbrief so aufzuzeichnen, daß das Ganze nicht verwirrend ist. Das Muster lebt von den Flottierungen, das Hintergrundgewebe ist durch sie verdeckt. Natürlich kann man es fadengenau – für jeden Faden ein Kästchen – darstellen, bekommt aber dann durch das Hintergrundgewebe eine Ansammlung bunter Kleckse, die einen vor allem dann durcheinanderbringt, wenn man versucht, wie bei pebble weave zu zählen. Wenn man den Aufbau der Muster einmal verstanden hat, kann man problemlos nach Foto oder einem fertigen Stück Stoff als Vorlage weben.
Mit drei Farben ist aber noch mehr möglich. In (1) und (2) sind einige Arten beschrieben.
Zunächst das nicht komplementäre dreifarbige pebble-weave Muster (analog Band 15 in (1)). Dieses ist einseitig, die Unterseite zeigt das Muster nicht klar, dafür ist es nicht so schwierig zu weben. Das Muster ist von einem Foto eines präkolumbischen Textils der Sammlung der Universität Erlangen (aus einer Veröffentlichung über experimentelle Archäologie) abgezeichnet.
 Vorderseite
Vorderseite
 Rückseite
Rückseite
 Webbrief
Webbrief
Das angefangene Muster im oberen Teil des Bandes ist komplementär analog der Beschreibung für Band 17 in (1) gewebt. Hier handelt es sich schon um eine spezielle Art Doppelgewebe, das Muster erscheint gegengleich auf Vorder- und Rückseite. Diese Webart ist deutlich schwieriger, da für das Muster auf der Unterseite ein zweites Fach in den richtigen Farben gebildet werden muß.
In (2) ist das Weben doppelseitig komplementär gemusterter Textilien mit noch mehr Farben beschrieben, hier ein Beispiel mit vier Farben:
Das mittlere Bild zeigt alle 8 möglichen Farbvarianten. Das Schären der Kette und das Anbringen der Litzen braucht viel Zeit, das Weben geht durch die doppelte Fachbildung und das Einlesen der Muster sehr langsam. Die unteren zwei Bilder zeigen gegenüberliegende unterschiedliche Motive auf Vorder- und Rückseite des Bandes, die Stecknadel dient als Anhaltspunkt. Auch das ist möglich, es ist einfacher, als die in (2) beschriebene komplizierte Technik, dauert aber.
Auf einer Webseite habe ich ein im Original dreifarbiges Muster einer mythischen Figur auf einer Ch’uspa (Tasche für Kokablätter) gefunden. Die Tasche ist aus präkolumbischer Zeit – Chimu- oder Chancay-Kultur – und in der Art des oben gezeigten einseitigen Fischmusters gewebt.
Ich habe daraus ein vierfarbiges Muster gemacht, bei dieser Breite kann man in der Stunde maximal 2 bis 3 cm weben.
 Vorderseite
Vorderseite
 Rückseite
Rückseite
 Webbrief
Webbrief
(1) „The Art of Bolivian Highland Weaving“ von Adele Cahlander und Marjorie Carson; 1976
(2) „Double-Woven Treasures from Old Peru“ von Adele Cahlander und Suzanne Baizerman; 1985